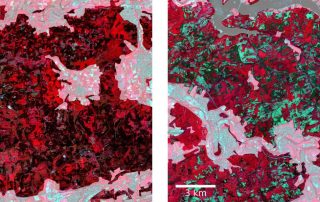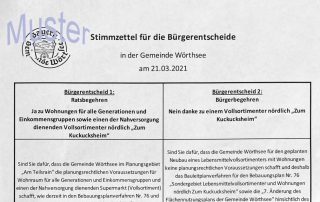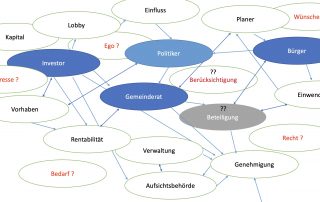Wörthsee soll kahler werden
Wörthsee soll kahler werden
Die Nachverdichtung der Bebauung in Wörthsee läuft. Alte Villen mit ihren Gärten müssen klotzigen Appartmentbauten weichen.
Die Gemeinde Wörthsee wird zugebaut. Foto: D.M.
„Unser Dorf soll schöner werden“
Unter diesem Titel wurden früher ländliche Gemeinden […]